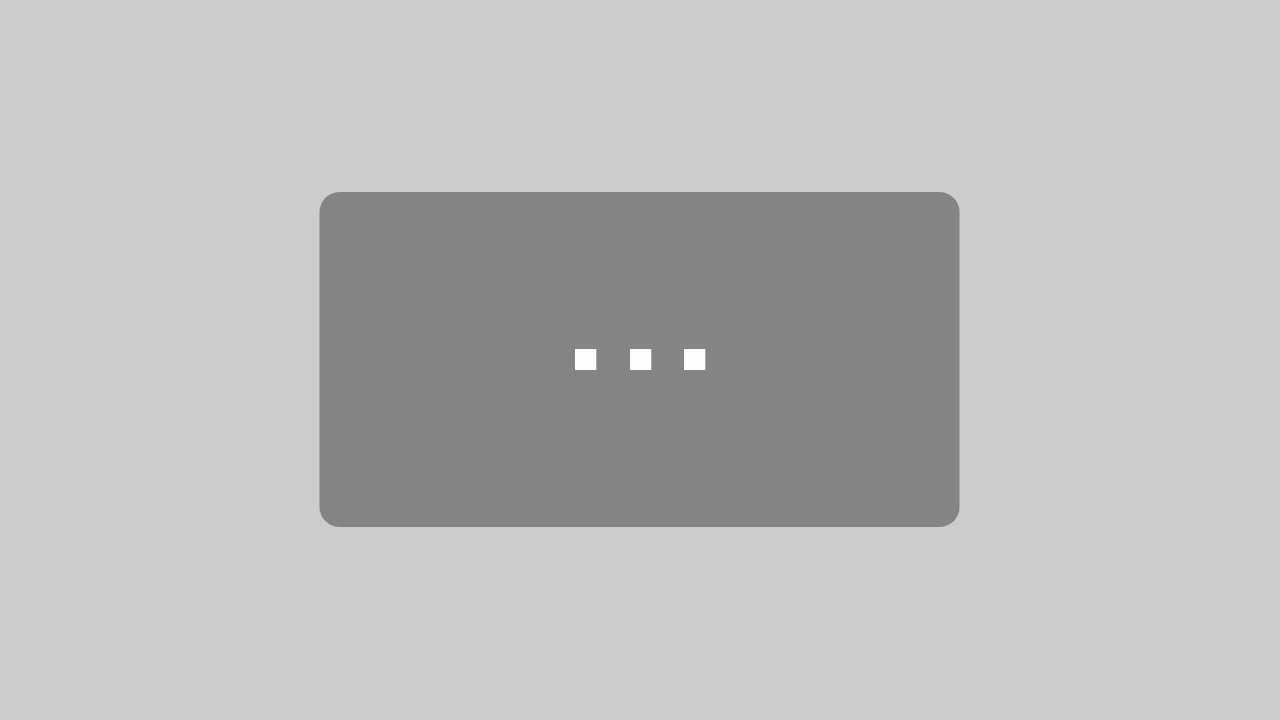Exkursionsreihe „Nachhaltige Lebenswelten“

Wie sieht das nachhaltige Leben eigentlich in der Praxis aus? In Schleswig Holstein gibt es diverse Projekte und Initiativen, die Lösungsmöglichkeiten für die Schwierigkeiten des nachhaltigen Alltags entwickelt haben. Sei es durch einen Bürgerbus, gemeinschaftliches Wohnen oder durch die Gründung einer solidarischen Landwirtschaft. In unserer Exkursionsreihe „Nachhaltige Lebenswelten“ besuchen wir genau diese Orte und Projekte. Wir schauen uns an, wie das nachhaltige Leben aussehen kann und welche Ideen und Lebensformen es bereits gibt. Wie lebt es sich in einem Wohnprojekt? Was ist eine Gemeinwohlökonomie-Gemeinde und wie funktioniert eigentlich ein Bürgerbus? Das sind nur einige der Fragen, denen wir dabei auf den Grund gehen wollen.
In den Exkursionberichten kannst du nachlesen, welche Orte wir uns angeschaut und was wir dabei gelernt haben. Schau doch mal rein!
Exkursionsberichte
Gemeinwohlökonomie: Exkursion nach Klixbüll am 06.08.2022
Klixbüll ist eine Gemeinde, die nach den Prinzipien der Gemeinwohlökonomie geführt wird und bei der alle politschen Entscheidungen mittels der „Sustainable Development Goals (SDG’s) auf Nachhaltigkeit geprüft werden. Darüber hinaus war Klixbüll die erste Gemeinde in Schleswig-Holstein, die die Agenda 2030 unterzeichnet hat.
Wie das in der Praxis aussieht, haben wir uns einmal angeschaut und sind mit dem vollelektrischem Schulbus der Gemeinde und Bürgermeister Werner Schweizer durch’s Dorf gefahren (worden).

Los ging es mit einem Besuch der Scheune der SoLaWi Kirchenhof Klixbüll e.V., wo uns der Vorsitzende Stephan Schirmer empfangen hat. Der Verein hat momentan 61 Mitglieder, von denen 43 einen Ernteanteil in Anspruch nehmen, d.h. wöchentlich Gemüse an der Abholstation Kirchenhof abholen. Dieses Gemüse ist die wöchentliche Ernte, verteilt auf 43 Anteile. Diese Menge unterliegt saisonalen Schwankungen.
Das Prinzip einer SoLaWi
Was nicht schwankt, ist der Preis. Dieser ermittelt sich aus den Kosten der SoLaWi, also dem Gehalt der Gärtner*innen, den Kosten für Saatgut und Flächen und so weiter. Daraus ergibt sich ein Gesamtbetrag, der im Jahr aufzubringen ist und auf die Ernteteiler*innen verteilt wird. Bei der SoLaWi Kirchenhof ist die Besonderheit, dass der Verein auch fördernde Mitglieder besitzt, d.h. die Kosten für einen Ernteanteil sind vergleichsweise niedrig, da die Gesamtkosten des Betriebs auf viele Schulter verteilt sind. Ein*e Ernteteiler*in verpflichtet sich immer für ein Jahr, damit der Betrieb Planungssicherheit durch feste monatliche Einnahmen hat. Missernten und Co. führen also nicht zu wirtschaftlichen Schäden, sondern werden von allen gemeinsam getragen.
Die SoLaWi Kirchenhof Klixbüll e.V. befindet sich noch im Aufbau, besitzt aber bereits 2,5 Hektar Fläche, gepachtet von der Kirchengemeinde, die den Verein generell untersützt. Theoretisch wären damit bis zu 300 Ernteteile möglich – doch dafür braucht es erst einmal Gärtner*innen und dementsprechend Geld. Doch Stephan Schirmer blickt optimistisch in die Zukunft und wird nach eigener Aussage nicht aufgeben, bis auch der letzte überzeugt ist.
Auch wenn es zu Anfang viel Gegenwind gab und manch ein Landwirt der Umgebung der SoLaWi mit ihrem Bioanbau einen Misserfolg wünschte, kommt die SoLaWi inzwischen bei allen gut an. Oder wie es der Bürgermeister der Gemeinde ausdrückte: Nothing beats success.

Ein „grünes“ Rathaus
Nach unserem Besuch beim Kirchenhof ging es weiter zum Wohnsitz von Werner Schweizer, der gleichzeitig als Rathaus der Gemeinde fungiert. Das Haus ist durch Solarmodule im Garten und eine Solarthermieanlage für warmes Wasser komplett unabhängig von fossilen Energien und auch die Toiletten im Keller orientieren sich an den Nachhaltigkeitszielen. Denn es handelt sich um Komposttoiletten. Noch funktionieren diese mit Wasserspülung, ein Umstand, den der Bürgermeister bedauert: ist es doch Wahnsinn in Zeiten von Wasserknappheit Trinkwasser zur Toilettenspülung zu verwenden.
Auch eine Biokläranlage findet sich im großen Garten des Hauses. Eine konventionelle Wasserklärung braucht für die Aufbereitung von einem Kubikliter Wasser etwa eine Kilowattstunde Strom, ist also energieaufwendig. Hier klären Pflanzen die Abwässer, sodass durch die Verwendung der Pflanzenkläranlage für Grauwasser der Energieverbrauch des Hauses weiter reduziert wird.
Auch eine Biokläranlage findet sich im großen Garten des Hauses. Eine konventionelle Wasserklärung braucht für die Aufbereitung von einem Kubikliter Wasser etwa eine Kilowattstunde Strom, ist also energieaufwendig. Hier klären Pflanzen die Abwässer, sodass durch die Verwendung der Pflanzenkläranlage für Grauwasser der Energieverbrauch des Hauses weiter reduziert wird.

Auf dem Acker der SoLawi werden sogar Melonen angebaut
Nach dem Besuch des Hauses und seiner Toiletten ging es weiter zum Acker der SoLaWi, wo wir uns den Gemüseanbau noch einmal genauer anschauten. Noch steht Hafer zwischen den Gemüsereihen, um den Boden aufzubereiten, da dessen Werte durch den konventionellen Anbau des Vorgängers im suboptimalen Bereich liegen. Geht es nach Stephan Schirmer, soll aber bald überall Gemüse wachsen und die SoLaWi noch größer werden.
Bis dahin staunen wir über Melone und Co. im Folientunnel und verspüren beim Anblick des ganzen leckeren Gemüses ein leichtes Hüngerchen.
Also ging es weiter zur Mittagspause in Richtung Dörpscampus, der Schule, Gemeindezentrum und Vereinsheim in einem ist. Unterwegs machten wir noch kurz Halt im Zweitwagenfreien Neubaugebiet der Gemeinde und besuchen die dortige Carsharingstation. Hier kann sich jede*r Bewohner*in für kleines Geld ein Auto (natürlich elektrisch) mieten und damit z.B. zum Einkaufen fahren.



Im DörpsCampus angekommen, gab es einen kleinen Imbiss, bevor uns Werner Schweizer noch einen Einblick in die theoretischen Hintergründe der Gemeinwohlökonomie und seine Motivation, die Ideen des nachhaltigen Lebens in die Praxis umzusetzen, gibt. Und auch ein nächstes Großprojekt für Klixbüll steht schon in den Startlöchern: Höhenwindkraft. Eine Anlage gibt es bereits und die Motivation diese Technik weiter auszubauen, ist auf jeden Fall vorhanden. Und auch über eine klimaneutrale Luftfahrt wird hier sehr intensiv nachgedacht.
Wir sind sicher, von Klixbüll haben wir nicht zum letzten Mal gehört.
Im Video gibt es noch ein paar weitere Eindrücke von Klixbüll:
Gemeinsam Wohnen: Exkursion zum Wohn- und Wirkprojekt Wandelgut
Am 6. September haben wir uns auf den Weg nach Mechow gemacht um das Wohnprojekt Wandelgut zu besuchen. Das Wandelgut ist eigentlich viel mehr als „nur“ ein Wohnprojekt – neben Wohnraum gibt es hier eine SoLaWi, eine TinyHouse Werkstatt, einen Mitgliederladen, eine Wiese für den Seminarbetrieb und noch viel mehr. All das ist verteilt auf drei Dörfer, sodass das Projekt Wandelgut doch deutlich über das Gutshaus hinausgeht. Aber von Anfang an:
In Mechow angekommen werden wir von Mona, einer der Bewohner*innen des Wandelguts in Empfang genommen. An einer großen alten Scheune und Pferden vorbei geht es auf die Wandelwiese. Hier stehen Zelte, eine Outdoorküche und viele Apfelbäume. Unter einem der Zelte lassen wir und nieder und sind gespannt was Mona uns so alles zu erzählen hat.

Die Wandelgut gGmbH
Wie bei vielen Wohnprojekten ist auch das Wandelgut über eine Kombination aus Vereinen und (gemeinnütziger) GmbH organisiert. Alle Grundstücke und Häuser werden von der Wandelgut gGmbH gekauft, welche diese wiederum den Vereinen zur Nutzung vermietet. Jedes Projekt hat also einen Verein, über den es seine Räumlichkeiten mieten kann. Die Bewohnenden haben ebenfalls einen Verein, den sogenannten Wohnverein, welcher den Wohnraum von der GmbH anmietet und an seine Mitglieder vermietet. Dieses Konzept führt dazu, dass alle Menschen sowohl in der GmbH als auch in den Vereinen ein Mitspracherecht haben – sie sind also gleichzeitig Mieter- und Vermieter*innen.
Im Wandelgut gibt es noch den kleinen Sonderfall, dass das Gutshaus zwar vom Wohnverein gemietet, jedoch nicht von der gGmbH gekauft werden kann, da es einer Privatperson gehört. Die weiteren Grundstücke und Gebäude des Guts hingegen können und werden nach und nach von der gGmbH gekauft und an die Projekte vermietet – was natürlich den Vorteil hat, dass nicht auf einmal eine riesige Summe aufzubringen ist, sondern nach und nach Flächen und Gebäude dazu gekauft werden um die Pläne der Menschen zu verwirklichen.
Die Projekte

nd Pläne gibt es viele für das Wandelgut – auch wenn diese momentan meist im Nachbarort Wietingsbek angesiedelt sind, so gehören sie trotzdem dazu. In Wietingsbek gibt es eine solidarische Landwirtschaft, den Mitgliederladen „Tante Wandel“, die Werkstatt für „Tiny Barns“ (Tiny Houses im Scheunenlook) und Wohnraum.
Auf dem Gelände rund um das Gutshaus wiederum findet sich der Gemüsegarten, die Wandelwiese, auf der im Sommer reger Seminarbetrieb herrscht, und diverse Gebäude aus denen später einmal Wohnraum werden soll – sobald die Finanzen und das Denkmalamt den Umbau gestatten. Ein zentrales Anliegen der Menschen des Wandelgutes ist es eben nicht nur zu Wohnen, sondern auch nach außen zu Wirken. Durch die Projekte soll dieses Ziel realisiert werden.



Soziokratie
In jedem Projekt müssen Entscheidungen getroffen werden – manchmal mit weitreichenden Konsequenzen wie z.B. der Kauf eines Hauses. Um die Entscheidungsfindung in geregelte Bahnen zu lenken haben sich die Menschen des Wandelgutes entschieden Entscheidungen nach dem Prinzip der Soziokratie zu treffen. In der Soziokratie werden Entscheidungen nach dem Konsent-Prinzip getroffen.
Das heißt, dass eine Entscheidung dann getroffen wird, wenn es keine schwerwiegenden Einwände dagegen gibt. Das heißt auch, dass nicht alle die Entscheidung spitze finden müssen. Um diesen Prozess etwas effizienter zu gestalten ist die Soziokratie in Kreisen organisiert. Beim Wandelgut gibt es also den Öffentlichkeitsarbeitskreis, den Gemeinschaftskreis, den Orgakreis etc. Diese Kreise habe alle klar definierte Bereiche über die sie entscheiden können und sind häufig noch einmal in Domänen unterteilt. Es gibt also kein großes Riesenplenum in dem alle Menschen des Wandelguts alle Entscheidungen treffen sondern die Kreise entscheiden innerhalb ihrer Bereiche selbst.

Ein wichtiges Prinzip ist hierbei: Good enough for now, save enough to try. Das heißt, dass eine Entscheidung dann getroffen wird, wenn keine großen Risiken damit verbunden sind. Dabei ist auch immer zu beachten, dass eine Entscheidung einem gemeinsamem Ziel dienen soll – Entscheidungen die einem Ziel, z.B. dem Ziel in der Dorfgemeinschaft positiv wahrgenommen zu werden, entgegen laufen, sind eben nicht gut genug für den Moment und können daher nicht getroffen werden. Alles in allem ist die Soziokratie auf dem Wandelgut der Versuch möglichst viele Menschen in die Entscheidungen mit ein zu binden ohne dabei immer alle anhören zu müssen – also eine gute Entscheidung möglichst effizient zu treffen.
Wir haben bei unserer Exkursion zum Wandelgut viel lernen dürfen. Weitere Einblicke bekommst du in unserem Video unten. Und wenn du dich auch für alternative Lebensweisen interessiert, dann schau doch mal oben bei unseren Exkursionsterminen und melde dich an!
Exkursion zur Allmende Wulfsdorf
Am 15. Oktober 2022 haben wir die Allmende Wulfsdorf ein (sehr großes) Wohnprojekt in Ahrensburg bei Hamburg besucht. Hier leben etwa 250 Menschen in mehreren Häusern. Außerdem gibt es ärztliche Infrastruktur, eine Turnhalle, ein Gemeinschaftshaus, ein Jugendhaus und ein Bestattungsinstitut. Man könnte also sagen, dass Allmende eher ein Dorf- als ein Wohnprojekt ist.
Früher wurde das Gelände als „Anstalt für schwer erziehbare Jugendliche“ genutzt. Junge Menschen sollten hier passend für die Gesellschaft gemacht werden – und wurden dafür teils auf dem Gelände eingesperrt. Als diese Praxis zunehmend unüblich wurde, wurde die Anstalt geschlossen und 1998 stand das Gelände mit den sich darauf befindlichen Gebäuden schließlich zum Verkauf
2004 erfolgte dann der Kauf durch die späteren Wohnungseigentümer*innen. Bevor die ersten Wohnungen bezogen werden konnten musste allerdings umfassend saniert, umgebaut, neu gebaut und umgestaltet werden. Auf alte Häuser kamen neue Obergeschosse, neue Häuser wurden gebaut und das Gelände umgestaltet, sodass heute wenig an die ehemalige Nutzung erinnert.

Da ein solches Projekt doch recht umfangreich ist, hatte die Gruppe damals professionelle Unterstützung durch Conplan. Conplan unterstütze nicht nur bei der Erstellung des Finanzplans sondern auch bei der Vermittlung von Architekt*innen, Landschaftsgärtner*innen und Co. Laut Aussage heutiger Bewohner, wäre das Projekt ohne professionelle Hilfe vermutlich nicht realisierbar gewesen.
Ein weiterer wichtiger Faktor in der Projektverwirklichung und der Grund, warum es eine Eigentümergemeinschaft und keine Genossenschaft oder ähnliches geworden ist, ist die Eigenheimzulage. Diese war notwendig, um das Projekt finanziell stemmen zu können, galt aber, wie der Name schon sagt, nur für Eigenheime.
Bei unserer Exkursion hatten wir die Gelegenheit Allmende im Rahmen eines Spaziergangs anschauen zu können. Vom „Torhaus“ über den „Dorfplatz“ vorbei an einem Wohnhaus für Menschen mit Betreuungsbedarf ging es an vielen Mehrfamilienhäusern vorbei zu den Gemüsegärten.

Diese sind in Parzellen aufgeteilt und werden befristet an gartenbegeisterte Bewohner*innen vergeben. Befristet, damit alle Interessierten mal zu einem Garten kommen, denn wie das häufig ist, gibt es mehr Gartenbegeisterte als zur Verfügung stehende Parzellen

Anschließen ging es weiter in den kleinen Wald der Allmende. Hier stehen zwei sogenannte Hallenhäuser, die vom Prinzip wie Einfamilienhäuser aufgebaut sind und entsprechend von wenigen Familien bewohnt werden.
Hier zeigt sich, dass Allmende versucht verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden – diejenigen, die gerne mittendrin sein möchten, wohnen am Dorfplatz, diejenigen, die ein höheres Bedürfnis nach Ruhe und Abgeschiedenheit haben, wohnen dann eben im Wäldchen. Generell ist die Gemeinschaft auch Allmende ein Zusammenschluss der verschiedensten Menschen und Weltanschauungen. Nazis und Co sind natürlich nicht toleriert, aber ansonsten sind die Menschen und ihre Bedürfnisse hier verschiedenen – und finden trotzdem irgendwie zusammen.
Aus dem Wäldchen hinaus ging es zu den Kleingewerbehallen und der Krippe, dann zum Holzkraftwerk und weiter zur Saatgutforschung. Hier wird daran gearbeitet vermehrungsfähige Gemüsesorten zu erhalten und weiter zu entwickeln um ein Gegenstück zu den großen Saatgutkonzernen, welche überwiegend hybrides Saatgut verkaufen, zu sein.


Geendet hat unser Spaziergang im Gemeinschaftshaus. Dieses Haus kann von allen Bewohner*innen für diverse Aktivitäten genutzt werden – also auch für eine große Fragerunde nach einem Dorfspaziergang.
Ein großes Thema war die Frage nach der Organisation des Miteinanders. 250 verschiedene Personen zu vereinen und dazu zu bringen miteinander freundlich und produktiv zu arbeiten hört sich erst einmal wie eine große Herausforderung an. Wie also werden auf Allmende Entscheidungen getroffen ?
Da es sich bei Allmende um eine Eigentümer*innengemeinschaft handelt, können rechtlich bindende Entscheidungen nur von der Eigentümer*innenversammlung getroffen werden. Mieter*innen haben hier kein Mitspracherecht. Da dies nicht dem Gedanken die Bedürfnisse aller zu hören und zu berücksichtigen entspricht, gibt es auf Allmende weitere Gremien:
Zum einen organisieren sich die Häuser selbst in ihren Hausgemeinschaften und entscheiden z.B. auch über neue Wohnungseigentümer*innen, wenn Wohnungen verkauft werden. Zum anderen gibt es den Dorfrat. Hier kommen alle Bewohnenden sowie Gewerbetreibenden zusammen und besprechen alle Themen, die es zu besprechen gilt. Die Entscheidungen des Dorfrates haben zwar keine rechtliche Relevanz, Probleme wie Ruhestörungen oder Dinge wie der Gartendienst können dort jedoch prima besprochen und gelöst werden.
Ein weiteres wichtiges Stichwort hier: Barrierefreiheit. Auch auf Allmende steigt der Altersdurchschnitt schneller als barrierearmer Wohnraum entsteht. Aufzüge sucht Mensch hier vergeblich und das wird zunehmend zum Problem. Älter werden auf Allmende? Gerade gar nicht so einfach. Aber daran wird gearbeitet und wir sind gespannt, wie die Menschen auf Allmende dieses Thema angehen und welche Lösungen sie finden.
Allmende ist also schon eine Art selbstverwaltetes Dorf, nur eben ohne kommunale Infrastruktur und alle die formalen Einheiten, die so ein Dorf so mit sich bringt. Ein etwas anderes Dorf eben.



Ihr möchtet mehr von Allmende sehen und hören? Dann schaut doch unser Video:
Wie lebt es sich in einem Wohnprojekt? – Ein Besuch auf dem Posthof
„Gemeinsam Wohnen und Leben“ – so einfach lässt sich das Prinzip von gemeinschaftlichem Wohnen auf den Punkt bringen. In den letzten Jahren hat diese alternative Lebensweise immer mehr an Attraktivität gewonnen. Aber was genau bedeutet „Gemeinsam Wohnen und Leben“ eigentlich? Wie lebt es sich in einem Wohnprojekt? Und warum entscheiden sich Menschen dazu in einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt zu leben?


Um Antworten auf diese Fragen zu finden und um uns ein eigenes Bild vom gemeinschaftlichen Leben in einem Wohnprojekt zu machen haben wir – eine kleine Gruppe neugieriger Menschen – uns an einem sonnigen Samstag im Juli auf den Weg gemacht, um den Posthof im Rahmen der Exkursionsreihe „Nachhaltige Lebenswelten“ zu besuchen. Der Posthof ist ein historischer Resthof in der Nähe von Rendsburg. Umgeben von Wiesen, Wald und Weiden leben dort 16 Menschen aus 3 Generationen in einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt zusammen mit Katzen, Pferden und Hühnern. Nach einer kurzen Fahrradtour vom Bahnhof in Rendsburg (der Posthof hat zwar eine Bushaltestelle, aber leider hält dort am Wochenende kein Bus) wurden wir auf dem Posthof von Franzi, Lachsi, Noah und Liesel herzlich in Empfang genommen.
Warum leben Menschen in einem Wohnprojekt?
Nach unserer Ankunft machten wir es uns unter dem Schatten der Bäume auf der Streuostwiese gemütlich. Und bei einem Glas selbstgemachter Limonade erzählte Franzi uns von gemeinschaftlichen Wohnprojekten und was sie gemeinsam haben. Denn obwohl jedes Wohnprojekt in seiner Form und Organisation einzigartig ist – manche richten sich an bestimmte Zielgruppen, wie ältere Menschen oder Alleinerziehende, andere sind generationenübergreifend organisiert und wieder andere legen einen Fokus auf eine nachhaltige, ökologische und vielleicht auch möglichst autarke Lebensweise – gibt es doch ein paar Gemeinsamkeiten. Ein entscheidendes Merkmal ist die Beteiligung der in dem Projekt lebenden Menschen an Prozessen und Entscheidungen. Außerdem gibt es immer eine Form von Gemeinschafsträumen und Gemeinschaftsflächen. Wie hoch der Grad der Beteiligung und der Anteil der gemeinschaftlich genutzten Flächen und Räume ist, ist von Projekt zu Projekt verschieden. So wird bei manchen Projekten wirklich alles gemeinschaftlich genutzt – von der Küche und dem Bad bis hin zu den Schlafräumen – und bei anderen beschränkt sich die gemeinschaftliche Nutzung auf bestimmte Teilbereiche, wie etwa den Garten oder einen Gemeinschaftsraum. Oft haben Gemeinschaftsprojekte darüber hinaus noch das Ziel auch mit den Menschen außerhalb des Projektes in Kontakt zu treten und mit Angeboten für alle einen Mehrwehrt für die Gesamtgesellschaft zu schaffen. Das kann ein Hofcafé, eine angegliederte Solidarische Landwirtschaft (SoLaWi) oder ein Seminar- und Workshop-Angebot sein.

Welche Frage uns aber am meisten interessierte: Warum entscheiden sich Menschen eigentlich dazu in einem Wohnprojekt zu leben? Wie wir in unserer Diskussion feststellten, können die Gründe hierfür sehr verschieden und individuell sein. Bei Patrick heißt es beispielsweise: „Ich bin nicht gern allein und möchte mit Menschen zusammenwohnen, die ich schätze.“ Aber auch die anderen aus unserer Gruppe können sich das Leben in einem Wohnprojekt vorstellen und sehen einige Vorteile im gemeinschaftlichen Wohnen: Etwa die Community, die sich unter die Arme greift und mit der sich auch (größere) Dinge realisieren lassen. Dinge, die sich für einen selbst oder wenige Personen oft schlichtweg einfach nicht lohnen, weil die Arbeitslast viel zu groß ist oder man keinen Platz dafür hat. Auch das Teilen von Ressourcen wie Werkzeuge oder Autos und die Unabhängigkeit von Entscheidungen des Vermieters stellen aus sich der Teilnehmenden große Pluspunkte dar.
Für Franzi steht vor allem auch die Mitbestimmung im Vordergrund: „Ich kann mir in einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt die Menschen, mit denen ich in meinem direktesten Umfeld zusammenlebe und mit denen ich viel Zeit verbringe, selbst aussuchen. Das geht bei anderen Wohnformen nicht, dort habe ich keinen Einfluss darauf, wie meine Nachbarschaft aussieht und wer neu hinzuzieht.“
Und eben all diese (auch von uns) genannten Punkte sind häufig die Beweggründe dafür, dass Menschen in einem Wohnprojekt leben. Es geht um den Anschluss an Gleichgesinnte, Zusammenhalt und Unterstützung in der Gemeinschaft, mehr Unabhängigkeit von der Gesamtgesellschaft und eine autarke bzw. selbstbestimmtere Lebensweise oder aber auch die Selbstverwirklichung.
Die Geschichte des Posthofs
Nach der ganzen Theorie wurde es Zeit sich ein wenig die Beine zu vertreten. Bei einer Führung über den Posthof haben uns Franz, Lachsi, Noah und Liesel dann noch mehr über die Entstehung des Projektes und das Leben vor Ort erzählt. Das tolle: sie nahmen dabei kein Blatt vor dem Mund und gingen auch ehrlich auf die Herausforderungen und Schwierigkeiten des gemeinschaftlichen Lebens auf dem Posthof ein. Gleichzeitig merkten wir ihnen aber auch immer wieder ihre Begeisterung für das Projekt an und wie wohl sie sich hier fühlen.
Zum Posthof gehören die Wohngebäude (das Haupthaus und der Bungalow) sowie verschiedene Nebengebäude, die unter anderem eine Holzwerkstatt, einen Fahrradschuppen und das kleine Seminarräumchen beherbergen sowie sieben Hektar Land. Im großen Garten gibt es einen gemeinschaftlichen Gemüsegarten, einen Kinderbereich sowie eine gemütliche Feuerstelle und einen Badezuber. Das restliche Land verteilt sich auf Wald und Grünland. Außerdem gibt es vor Ort noch Hühner, einen Wagenstellplatz und eine Pferdepension. Anfang 2019 wurde das Wohnprojekt auf dem Posthof von zwei jungen Familien gegründet. Die Idee eines gemeinschaftlichen Wohnprojektes im ländlichen Raum bestand schon länger und die intensive Planung begann schon ein Jahr zuvor und nachdem sie sich auf Anhieb in den Posthof verliebten, ging es plötzlich ziemlich schnell.


Quasi von jetzt auf gleich gründeten sie eine eingetragene Genossenschaft (eG), schrieben sich eine Satzung, erarbeiteten ein Finanzierungskonzept, sammelten das Geld für das Eigenkapital (in Form von Privatvermögen und Direktkrediten von Freund*innen und Familie) zusammen und klapperten mehrere Banken ab, bis sie schließlich eine Bank fanden, die das Projekt unterstützte. Im April 2019 zogen dann die ersten Bewohner*innen auf dem Posthof ein und es wurde mit den Umbau- und Renovierungsarbeiten begonnen.
Exkurs: Warum eine Genossenschaft gründen?
Die Genossenschaft ist ein gut erprobtes Modell für Gemeinschaftsprojekte dieser Art und bietet allen Mitgliedern eine hohe Sicherheit. Die Mitglieder haben ein lebenslanges Wohnrecht in dem Wohnprojekt und jedes Mitglied hat unabhängig davon, wie viele Anteile gekauft wurden, eine gleichberechtigte Stimme. Die Mitglieder zahlen keine normale Miete, sondern eine Nutzungsgebühr für das Objekt. Diese deckt die Nebenkosten, die Kosten für die Instandhaltung und in der Startphase auch die Kreditraten. Ziel ist es im Laufe der Zeit, also wenn der Kredit zurückgezahlt ist, die Nutzungsgebühr immer weiter zu verringern. Die eG ist nicht gewinnorientiert, das heißt, etwaige Gewinne werden an die Mitglieder ausgeschüttet oder ggf. in die Instandhaltung investiert. Über die Höhe der Instandhaltungskosten (und damit auch der Nutzungsgebühr) wird gemeinschaftlich entschieden.
Wandel gehört dazu
In der noch recht kurzen Zeit seines Bestehens gab es bereits viele, teils gravierende, Veränderungen auf dem Posthof. Die Zusammensetzung der Bewohner*innen hat sich mehrfach geändert. Die einen gingen im Streit, die anderen aufgrund veränderter Familienbedürfnisse und wieder andere kamen und wurden von „einfachen“ Mieter*innen zu einem Teil der Gemeinschaft. Auch das Zusammenleben im Haupthaus wurde von einer Art großen WG, in der bis auf die Schlafräume alles geteilt und auch gemeinsam gegessen wurde, in abgeteilte Wohnbereiche für jede Familie umstrukturiert. Darüber hinaus wurden ursprüngliche Ideen wie einer Senior*innen-WG oder zu vermietende Ferienwohnungen wieder verworfen. Auch die Rechtsform wurde von einer Genossenschaft in eine Wohnungseigentümer*innengenossenschaft umgewandelt. Durch diese Änderungen wurden zum einen Anreize geschaffen, sich mit mehr Anteilen im Gemeinschaftsprojekt zu beteiligen. Gleichzeitig besteht nun aber auch die Möglichkeit unbegrenzt zur Miete zu wohnen, ohne sich in die Genossenschaft einkaufen zu müssen. Auch die Arbeitslast im Rahmen des Gemeinschaftsprojekts wurde verringert. Musste jede Einzelperson zu Beginn 20 Stunden in den Hof stecken (beispielsweise Pferdepension, Renovierung und Instandhaltung der Gebäude, Weidepflege etc.), kann nun jede*r selbst entscheiden, wie viel Arbeit möchte oder kann ich für das Projekt leisten. Die geleisteten Arbeitsstunden werden als Mietminderung gutgeschrieben.


Natürlich waren manche dieser Zeiten auch sehr stressig und belastend, wie Franzi uns erzählt. Aber sie waren auch mit wichtigen Learnings und der Erkenntnis verbunden, dass Wandel mit den Menschen, die hier leben, irgendwie auch ein Stück weit dazugehört.
Leben auf dem Posthof
Und wie lebt es sich nun auf dem Posthof? Einen kleinen Eindruck konnten wir hautnah erleben. Wie leider so oft im ländlichen Raum, ist die Anbindung an den ÖPNV nicht unbedingt immer optimal. Aber mit dem Fahrrad ist es nicht weit bis nach Rendsburg und auch sonst sind wichtige Orte der Nah- und Daseinsversorgung (z.B. KiTa, Einkaufsmöglichkeiten etc.) gut erreichbar.


Vor Ort gibt es verschiedene Wohnformen: von eigenständigen Wohnungen im Bungalow über einen Bauwagen auf dem Wagenstellplatz hin zu abgetrennten Wohnbereichen im Haupthaus. Jeder Wohnbereich verfügt über eigene Schlafräume, eine Küche, Badezimmer und ein Wohnzimmer, so dass jede Familie einen eigenen Rückzugsort hat. Die Flure sind aber Gemeinschaftsflächen. Das führt dazu, dass sich die Kinder frei bewegen und mal bei der einen und mal bei der anderen Familie verweilen. Ein wichtiger Ort der Begegnung ist der große Garten. Dort wird sich auf einen Kaffee getroffen, abends zusammen am Lagerfeuert gesessen, gemeinsam gegessen, gelacht oder Musik gemacht.
Auch andere Bereiche wie etwa die Holzwerkstatt werden gemeinschaftlich genutzt. Dort gibt es ein Schraubenregal zum Selbstkostenpreis, ein Teil der Werkzeuge gehört der Genossenschaft und ein anderer Teil den einzelnen Bewohner*innen, die diese allen zur Nutzung zur Verfügung stellen. Einige Grundnahrungsmittel werden in Großgebinden gekauft und alle Mitglieder der Gemeinschaft können sich daran bedienen. Die Posthof-Bewohner*innen kümmern sich auch gemeinschaftlich um die Hühner und den Hofkater. Dazu gibt es einen wöchentlichen Dienstwechsel. Ein weiterer wichtiger Dienst für alle Bewohner*innen des Haupthauses ist der Ofendienst. Gleich zu Beginn der Renovierungsarbeiten wurde die alte Ölheizung durch einen modernen Holzvergaserofen ausgetauscht und dieser will für die Wärmeversorgung (Heizung und Warmwasser) regelmäßig mit Scheitholz bestückt werden. Im Sommer seltener und in der kalten Jahreszeit dafür umso öfter. Dazu gibt es sogar eigens eine selbst entwickelte Posthof-App, in der nachgeschaut werden kann, ob Holz nach nachgelegt werden muss. Inzwischen sind auch weitere Funktionen dazu gekommen, wie etwa die Übersicht über die aktuell eingespeiste Strommenge aus der Photovoltaik-Anlage, die Dienste für Ofen, Hühner und Kater, ein Kalender sowie das gemeinsame Carsharing.


Ansonsten gibt es jeden Mittwoch einen Gemeinschaftsabend und einmal im Monat ein Plenum. Vier Mal im Jahr wird ein Aktionstag veranstaltet, bei dem sich die Bewohner*innen einen ganzen Tag Zeit nehmen, um gemeinschaftliche Arbeiten am Hof zu verrichten, etwa zur Instandhaltung der Nebengebäude. Die Teilnahme am Plenum ist wichtig und darüber hinaus kann jede*r für sich selbst entscheiden, wie viel und was man machen möchte und wie man am Gemeinschaftsleben teilnehmen möchte.
Wir haben uns übrigens während der Führung einer kleinen „Eignungsprüfung“ gestellt, um zu sehen, wie wir uns auf dem Posthof schlagen und ob wir uns für ein Leben im Gemeinschaftsprojekt eignen würden. Anhand verschiedener kleiner Spielchen, die typischen Aufgaben auf dem Posthof nachempfunden waren, konnten wir unsere Fähigkeiten unter Beweis stellen. Dazu gehörten beispielsweise das Entfernen von Ampferpflanzen auf der Wiese, das Einfangen ausgebüxter Hühner (zum Schutz der Tiere wurden gebastelte Hühner versteckt) oder ganz wichtig, das Aufstapeln der Holzscheite für den Holzvergaserofen. Diese kleinen „Prüfungen“ haben wir mit Bravur bestanden. 😉


Zum Abschluss unseres Ausflugs auf den Posthof haben wir uns noch einmal unter die Bäume auf der Streuobstwiese mit Franzi, Lachsi, Noah, Liesel und weiteren Bewohner*innen des Posthofs zusammengesetzt und bei frischem Salat aus dem Gemüsegarten und einer kleinen Brotzeit weiter über das Leben in einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt zu sprechen.

Unser Besuch auf dem Posthof hat uns wahnsinnig gut gefallen, wir haben tolle neue Eindrücke gewonnen, uns bei den Bewohner*innen willkommen gefühlt und können sagen, wir könnten uns ein Leben in einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt wie dem Posthof ziemlich gut vorstellen!
Danke an Franzi, Lachsi, Noah und Liesel!
Du willst mehr über den Posthof erfahren, dann schau doch mal im Netz auf der Homepage und Instagram oder vor in Person vor Ort vorbei.
Wie sieht die Stadt von Morgen aus? – Suffizienter Stadtrundgang durch Flensburg
Die Schaffung nachhaltiger Städte und Gemeinden ist eines der 17 Ziele für Nachhaltige Entwicklung (Sustainable Developmental Goals, SDGs) der Vereinten Nationen. In Ziel 11 heißt es, Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen. Aber wie wird aus einer Stadt eine nachhaltige Stadt und warum ist die nachhaltige Entwicklung von Städten so wichtig?
Antworten auf diese Fragen haben wir bei einem Suffizienten Stadtrundgang durch Flensburg im Rahmen unserer Exkursionsreihe „Nachhaltige Lebenswelten“ erhalten. Anhand von 7 Stationen zeigte uns Clara vom Transformativen Denk und Machwerk e.V. die Stadt mal aus einer ganz anderen Perspektive und gab uns Einblicke in Chancen und Herausforderungen einer Suffizienz-orientierten Stadtentwicklung. Die zentrale Leitfrage, die uns auf dem Weg begleitet hat, war: Wie sollen Stadträume gestaltet sein und wie können wir in einer Stadt künftig gut und ressourcenarm gemeinsam leben?
Station 1: Was ist eigentlich Suffizienz?
An der ersten Station unseres Rundgangs am Museumsberg haben wir uns nach einer kurzen Vorstellungsrunde erst einmal mit dem Begriff der Suffizienz beschäftigt. Suffizienz ist neben Effizienz und Konsistenz wesentlicher Bestandteil einer jeden Nachhaltigkeitsstrategie. Anders als die technisch orientierten Strategien der Effizienz und Konsistenz, bei denen es darum geht Ressourcen und Energie besser zu nutzen (Effizienz) und Ressourcenkreisläufe zu schaffen (Konsistenz), zielt die Strategie der Suffizienz vor allem darauf ab, den Energie- und Materialverbrauch auf ein umweltverträgliches Maß zu begrenzen.
Angesichts der globalen Krisen, wie etwa dem Klimawandel und den fehlenden Erfolgen, den Ressourcenverbrauch allein durch effiziente und konsistente Lösungsansätze zu reduzieren (oft tritt hier der „Rebound-Effekt“ ein, wenn Effizienz-Einsparungen durch vermehrte Nutzung oder Konsum wieder zunichte gemacht werden), wird deutlich, dass ein „Weiter so“ nicht möglich ist. Im Sinne der Suffizienz müssen wir unser Verhalten verändern und Praktiken, die übermäßig Ressourcen verbrauchen, einschränken oder ersetzen. Dies trifft sowohl auf unseren persönlichen Alltag zu, aber auch auf gesellschaftliche Strukturen. Denn wir können die Sicherung unserer Lebensgrundlagen für heutige und kommende Generationen nicht allein dadurch wahren, dass Einzelne von uns ihre Essgewohnheiten ändern oder häufiger Mal mit dem Fahrrad fahren.
Eine Suffizienz-orientierte Stadtentwicklung hat zum Ziel, dass Stadträume für möglichst viele Menschen nutzbar sein sollen. Damit sich die Menschen auch suffizient verhalten, werden Strukturen benötigt, die es uns bequem, einfach und alltagstauglich machen unsere Verhaltensweisen in Richtung Suffizienz zu verändern. In Flensburg soll mit dem Hafen-Ost ein suffizientes Quartier entstehen. Ziel ist es einen Ort für Wohnen, Gewerbe, Wissenschaft, Kultur und Freizeit zu schaffen, an dem die Bewohner*innen ein alltagstaugliches und ressourcensparendes Leben führen können. Dabei wird im Planungsprozess auch immer wieder die Nachhaltigkeitsstrategie der Suffizienz mit einbezogen. So soll letztlich ein zukunftsfähiges Quartier mit viel öffentlichem Raum, wenig versiegelter Fläche und Pro-Kopf-Wohnfläche sowie viel Platz für Radfahrer*innen, Fußgänger*innen und den ÖPNV entstehen. Wir sind positiv von dieser Idee angetan und schon ganz neugierig, wie es am Ende aussehen wird.
Station 2: Die Bedeutung von öffentlichen Freiräumen
Für die zweite Station führte Clara uns in den Stadtpark. Dort erzählte sie uns von öffentlichen Freiräumen wie etwa Parks und Grünflächen. Parks und Grünflächen zählen zu grüner Infrastruktur und das Meer, Flüsse oder Seen zu blauer Infrastruktur. Der Zugang zu ihnen stellt einen wichtigen Baustein für die Lebensqualität in Städten dar. Sie bieten eine Alternative zum Wohnen im Grünen am Stadtrand und bieten bei kleinen Wohnflächen und dichter Besiedelung ein attraktives Wohnumfeld. Denn sie schaffen Frischluftschneisen, ein gesünderes Stadtklima, dienen der biologischen Vielfalt und Bodengesundheit und fungieren als wichtige Orte der Erholung, Begegnung, Kommunikation und für Sport und Spiel.
In Flensburg gibt es ganze 16 Parks und 63 Kleingartenanlagen. Im Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) wird die Bedeutung dieser öffentlichen Orte als lebendige Räume betont und die Erhaltung dieser Flächen vorgesehen. Leider entstehen aber aufgrund eines hohen Flächennutzungsdrucks konkurrierende Nutzungsansprüche – eine wachsende Bevölkerung steht in Konkurrenz zu Frei- und Grünflächen sowie Naturschutz- und Klimaschutzmaßnahmen. Dies gilt es genauestens abzuwägen und mögliche Alternativen zu prüfen.
Station 3: Bauen und Wohnen in einer wachsenden Stadt nachhaltig gestalten
Für die nächste Station machten wir am Diakonissenkrankenhaus Halt. Dieses soll zukünftig mit anderen Einrichtungen und Krankenhäusern an einem neuen Standort zu einem Zentralkrankenhaus zusammengelegt werden. Aber was geschieht dann mit dem alten Diakonissenkrankenhaus? Angesichts des steigenden Flächenverbrauchs und -bedarfs für die Siedlungsentwicklung (die Siedlungs- und Verkehrsflächen haben sich in den letzten 60 Jahren mehr als verdoppelt) wird immer wieder nach Alternativen zur Neuversiegelung von Flächen gesucht. Eine Möglichkeit ist beispielsweise die Nachnutzung von Konversionsflächen. Also die Änderung der Nutzung von Flächen, Gebäuden oder Anlagen. Auch das Diakonissenkrankenhaus soll umgenutzt werden, hier sollen neue Wohnungen entstehen. Außerdem sollen in Flensburg aufgrund von Flächenknappheit und mangelnden Wohnflächen, keine „neuen, klassischen, freistehenden Einfamilienhäuser“ mehr entstehen. Denn die Nutzung von Wohnflächen spielt eine große Rolle bei der gerechten Verteilung von innerstädtischen Räumen.
Mit 44 Quadratmetern pro Person liegt die durchschnittliche Wohnfläche in Flensburg zwar 2 qm unter dem Bundesdurchschnitt, aber seit den 1960er Jahren hat sich die durchschnittliche Wohnfläche in Deutschland mehr als verdoppelt. Um diesem Trend entgegenzuwirken gibt es verschiedene Ansätze. Eine Idee ist beispielsweise die Wohnflächen an die Bedürfnisse der jeweiligen Lebensphase der Menschen anzupassen und so eine optimale Nutzung der bestehenden Einfamilienhaus-Flächen zu erreichen. Häufig bleiben Eltern oder ältere Personen auch nach dem Auszug der Kinder oder dem Tod eines Partners in dem großen Haus wohnen. Würde man diese etwa bei einem Umzug in kleinere Wohnungen unterstützen, könnten die freiwerdenden Wohnhäuser von Familien mit größerem Platzbedarf genutzt werden. Außerdem kann auch die Förderung anderer Wohnformen in den Fokus gerückt werden. Mit Wohngemeinschaften, Cluster-Wohnungen (Kreuzung zwischen Wohngemeinschaft und Kleinstwohnung: mehrere private Wohneinheiten inkl. Bad, die sich Gemeinschaftsräume und Infrastruktur teilen) oder Wohnungen mit gemeinschaftlich genutzten Räumen lässt sich die Pro-Kopf-Wohnfläche deutlich reduzieren.
Darüber hinaus kann die Stadt deutlich mehr Einfluss auf die gemeinwohlorientierte Nutzung und Gestaltung der Flächen nehmen, wenn diese Grundstücke längerfristig in der Hand der Stadt bleiben, zum Beispiel durch Verpachtung.
Station 4: Kleinteilige, dezentrale, nachhaltige Konsumstrukturen
Zur nächsten Station führte Clara uns durch die Norderstraße zum Aktivitetshuset. Anders als die Innenstadt Flensburg, die mit Einkaufsstraße und Einkaufszentren in der Peripherie mehr ein Ort des Konsums ist, ist das Aktivitetshuset ein gutes Beispiel für einen innerstädtischen konsumfreien Ort. Das Projekt- und Kulturhaus der dänischen Minderheit bietet Menschen die Möglichkeit die Räume zu nutzen, handwerklich aktiv zu werden Dinge zu reparieren oder sich zu treffen. Kleinteilige, dezentrale und nutzungsgemischte Versorgungsinfrastrukturen, wie sie in der Norderstraße zu finden sind, spielen eine bedeutende Rolle in einer Suffizienz-orientierten Stadt, da sie kurze Wege für die Menschen bedeuten und somit klimafreundliche Mobilität begünstigen. Auch die ehemaligen Kaufmannshöfe bieten Alternativen zum „klassischen“ Konsum. Hier finden sich kleine Geschäfte und Restaurants, Manufakturen, Angebote der Reparatur, zum Nähen oder Second Hand, die gemeinsam mit kleineren Plätzen, die zum Verweilen einladen, die Aufenthaltsqualität steigern und zum Flanieren einladen.
Station 5: Partizipation und Bürgerbeteiligung
Ebenfalls in der Norderstraße befindet sich der Projektraum „hundertacht“. Wie Clara uns berichtet, befindet sich dort die Verteilstation der Solidarischen Landwirtschaft aus Wanderup sowie eine solidarische Einkaufskooperative, Foodsharing und die Küche für alle. Dort sollen sozial-ökologisches Denken und Handeln gefördert und Ideen zu alternativen Konsum- und Lebensweisen entwickelt werden. Sie dient als Beispiel dafür, dass eine sozialverträgliche, umweltschonende Lebens- und Wirtschaftsweise gelebt werden kann. Die „hundertacht“ lebt vom Engagement und Veränderungswillen aktiver Einwohner*innen. Die Beteiligung von Bürger*innen an der Stadtgestaltung ist ein zentrales Element für einen Suffizienz-orientierten Wandel. Durch kooperative Beteiligungsprozesse und gemeinschaftliche Entscheidungsfindungen können den Einwohner*innen Wissen und Ansätze für nachhaltige Verhaltens- und Lebensstilveränderungen vermittelt werden, so dass eine Akzeptanz für nachhaltige Veränderungen entsteht. Um jedem Menschen, der in Flensburg lebt, die Möglichkeit zu geben sich an Stadtentwicklungsprojekten zu beteiligen, wurde von der Stadt eine Richtlinie zur Einwohner*innen-Beteiligung verabschiedet.
Station 6: Mobilität – Der Umstieg vom Auto zu ÖPNV und Fahrrad
Für die vorletzte Station führte uns Clara runter ans Wasser zur Schiffbrücke. Dort suchten wir uns ein gemütliches Plätzchen am Hafen und lauschten zunächst einmal mit geschlossenen Augen der Umgebung. Wir ließen die Geräusche auf uns wirken und stellten fest, dass der Straßenlärm der Schiffbrücke, einer viel befahrene Hauptstraße, die den Innenstadtbereich von dem Hafen trennt, sehr dominant ist. Generell wurden Städte in der Vergangenheit vorrangig für Autos gestaltet. Dies fällt auf, wenn man sich anschaut, wie viel Fläche der motorisierte Individualverkehr für den fließenden Verkehr, aber auch fürs Parken beansprucht. So benötigt ein geparktes Auto eine Fläche von 20 Quadratmetern (geparktes Fahrrad: 2 qm; Fußgänger*in, stehend: 0,5 qm) und ein 50 km/h schnell fahrendes Auto bereits die 7-fache Menge, also 140 Quadratmeter (Fahrrad mit 15 km/h: 5 qm; Fußgänger*in, laufend: 2 qm).
Eine Suffizienz-orientierte Stadtentwicklung sieht vor, sich vom Leitbild der autogerechten Stadt zu entfernen. Dazu müssen aber suffiziente Mobilitätsformen wie die Nutzung von Fahrrad, des ÖPNVs oder auch der eigenen Füße so gestaltet sein, dass sie für viele Menschen attraktiv und bequem sind. Die Stadt muss attraktive Möglichkeiten und Anreize sowie die geeigneten Rahmenbedingungen schaffen, für die es sich lohnt das Auto stehen zu lassen. Eine gut ausgebaute Infrastruktur oder auch Sharing-Angebote ermöglichen den Menschen auf einfachem Weg, zum Beispiel durch kurze Distanzen oder gute Taktung des ÖPNVs, ihre Bedürfnisse erfüllen zu können. Gleichzeitig muss die Nutzung des Autos möglichst unbequem gemacht werden. Dies kann beispielsweise durch Reduzierung der Fahrbahnen und PKW-Stellflächen sowie eingeschränktes und verteuertes Parken geschehen. Eine Umverteilung der Straßenräume zu Lasten des Autos, schafft zudem neue Räume, die als Aufenthalts- und Naherholungsorte genutzt werden können.
Station 7: Keine neuartigen Gedanken – aber neues Handeln!
Am Kompagnietor, unserer letzten Station, angekommen, wies Clara uns auf das Zitat hin, das über dem Torbogen prangt:
„Gerecht und etich alltidt sin Mit Gades hülp bringt grodt Gewin“
(Gerecht und mäßig allzeit sein mit Gottes Hilfe bringt großen Gewinn)
Wie sich herausstellt ist Suffizienz, also Mäßigung und ein sparsamer und bewusster Umgang mit dem, was da ist, gar kein so neuer Gedanke. Wir haben es nur vergessen und im Laufe der Zeit haben sich Strukturen herausgebildet, bei denen ressourcenintensive Praktiken zur Norm geworden sind, weil sie scheinbar mit mehr Annehmlichkeiten verbunden sind. Dabei werden langfristige Folgen für die Umwelt oder das gesellschaftliche Zusammenleben einfach ausgeblendet.
Was wir bei diesem Stadtrundgang mitgenommen haben, ist, dass Suffizienz nicht immer automatisch Verzicht bedeuten muss. Sondern, dass es vielmehr darum geht, aufzuzeigen, dass das gute Leben nicht automatisch mit immer noch mehr verbunden sein muss. Suffizienz-orientierte Stadtentwicklung bringt die Bedürfnisse der Menschen in eine angemessene Balance mit den ökologischen Grenzen und sozialer Gerechtigkeit und schafft so eine lebendige Stadt mit großer Lebensqualität.
Danke an Clara und das Transformative Denk und Machwerk e.V. für diesen tollen Stadtrundgang und die vielen Einblicke, wie eine nachhaltige und lebenswerte Stadt von Morgen aussehen kann.
Lust bekommen?
Du willst den Stadtrundgang selbst einmal mitmachen? Das Transformative Denk und Machwerk e.V. bietet immer wieder Termine an. Du kannst den Stadtrundgang aber auch eigenständig mit der Actionbound-App absolvieren. Alle Infos dazu und Termine für den Stadtrundgang findest du hier.